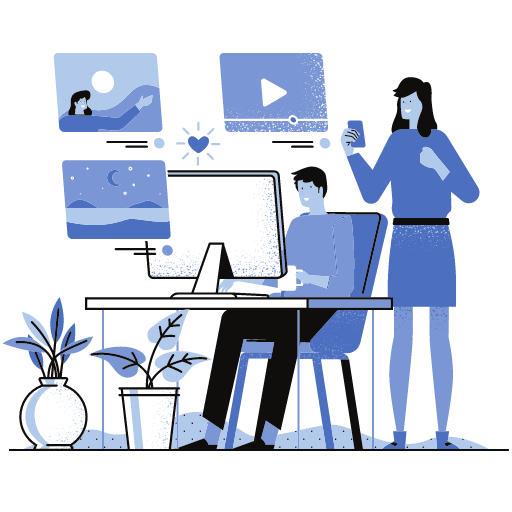Berichterstattung über psychische Erkrankungen
Psychische Erkrankungen sind ein schwieriges Thema, das neben einer sehr guten Recherche auch viel Fingerspitzengefühl erfordert. Eine Berichterstattung zu vermeiden, würde psychische Erkrankungen aber noch mehr zum Tabu-Thema machen, als sie es ohnehin schon sind.
Inhalt
Psychische Erkrankungen – weit verbreitet, aber tabuisiert
Aus einer Studie des Robert-Koch-Instituts geht hervor, dass jedes Jahr allein in Deutschland fast sechs Millionen Erwachsene im Alter zwischen 18 und 65 Jahren an einer Depression erkranken.
Wird die Gesamtzahl derjenigen betrachtet, die irgendwann einmal im Verlauf ihres Lebens mit einer Depression zu kämpfen haben, so ist fast jeder Fünfte betroffen. Die Anzahl der Todesfälle durch Suizid beläuft sich laut Statistischem Bundesamt auf rund 10.000 Menschen jährlich. Viele Suizide stehen mit einer psychischen Erkrankung in Verbindung, die häufigste Ursache ist eine Depression.
Allein schon anhand dieser paar Zahlen wird deutlich, wie viele Betroffene es gibt und wie groß die gesellschaftliche und die gesundheitspolitische Bedeutung dieser Thematik ist. Aber obwohl fast schon von einer „Volkskrankheit“ gesprochen werden kann, sind Depressionen und andere psychische Erkrankungen nach wie vor ein gesellschaftliches Tabu.
Psychisch kranke Menschen sehen sich mit vielen Vorurteilen konfrontiert, sofern ihre Erkrankung überhaupt als Krankheit ernst genommen und der Betroffene nicht nur als Simulant abgetan wird. In den Medien wiederum tauchen psychische Erkrankungen vor allem im Zusammenhang mit Verbrechen, Gewalttaten und von den Normen abweichenden Verhaltensweisen auf.
Gleichzeitig wird die Psychiatrie oft als eine Art Sackgasse dargestellt, aus der es kaum noch ein Zurück gibt. Beiträge darüber, wie Betroffene eine psychische Erkrankung erfolgreich bewältigt haben, finden sich hingegen äußert selten. Diese recht einseitige Darstellungsform hat zwei Auswirkungen. Zum einen werden die Vorurteile gegenüber psychisch Kranken weiter verstärkt. Und zum anderen fürchten Betroffene eine Stigmatisierung und nehmen deshalb die dringend benötigte Hilfe nicht oder erst viel zu spät in Anspruch.
Verantwortungsvoll und differenziert berichten
Wenn in den Medien über körperliche Erkrankungen berichtet wird, werden üblicherweise die Symptome, die Diagnosemöglichkeiten, die Therapien und die Heilungschancen beschrieben. Außerdem kommen oft Betroffene oder Angehörige zu Wort, die davon erzählen, wie sie mit der Diagnose umgehen und ihren Alltag meistern.
Geht es um psychische Erkrankungen, rücken solche Aspekte häufig in den Hintergrund. Dabei sind es gerade die Medien, die viel dazu beitragen könnten, über psychische Erkrankungen aufzuklären und dieses Thema aus der Tabu-Zone zu holen. Immerhin sind die Medien eine der wichtigsten Quellen, die die Öffentlichkeit nutzt, um sich zu informieren.
Aber: Wenn Medien über psychische Erkrankungen berichten, müssen sie sich ihrer Verantwortung bewusst sein und sich um eine sachgemäße und differenzierte Darstellung bemühen. Hierzu gehört zunächst einmal, dass sich der Journalist mit den Begrifflichkeiten auseinandersetzt. Der Ausdruck psychische Erkrankungen umfasst eine Vielzahl verschiedener Krankheitsbilder mit unterschiedlichen Symptomen.
Der Journalist sollte deshalb darauf achten, dass er spezifisch formuliert und dabei die Fachausdrücke richtig verwendet. Außerdem sollte er auf eine Sprache achten, die keine Wertungen vornimmt und den Betroffenen nicht nur auf seine Erkrankung reduziert. Spricht der Journalist im Zuge seiner Recherche mit Betroffenen, Angehörigen und Experten, kann er ein Gesamtbild zeichnen, das die Thematik aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet.
Psychische Erkrankungen im richtigen und großen Kontext
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der Kontext, in den die psychische Erkrankung eingebettet ist. Grundsätzlich sollte der Journalist das große Ganze sehen und die Zusammenhänge richtig einordnen.
Das beginnt schon bei den Informationen über die Erkrankung. Jede psychische Erkrankung ist behandelbar. Viele Krankheitsbilder sind heilbar und selbst bei einer Krankheit, die immer wieder auftritt oder einen chronischen Verlauf nimmt, gibt es gute Bewältigungsstrategien.
Wenn der Journalist solches Wissen vermittelt, kann er nicht nur dazu beitragen, dass Stigmata und Tabus abgebaut werden. Sondern er kann auch Betroffenen Ängste nehmen und ihnen Mut machen, sich Hilfe zu suchen.
Noch wichtiger ist die richtige Einordnung aber, wenn es um Straftaten geht. Natürlich gibt es Verbrechen und Gewalttaten, die auf eine psychische Erkrankung zurückzuführen sind. Aber längst nicht jeder Straftäter ist psychisch krank. Und selbst wenn bei einem Straftäter eine psychische Erkrankung festgestellt wurde, muss sie nicht automatisch der Auslöser der Straftat gewesen sein.
Selbstverständlich ist es legitim, nach den Ursachen für eine Straftat zu fragen. Doch der Journalist sollte sich nicht auf Spekulationen einlassen oder vorschnelle Schlüsse ziehen. Stattdessen sollte er umfassend recherchieren und sich auf gesicherte Fakten berufen.
Auch ein Verweis auf die wissenschaftliche Datenlage ist sinnvoll. Denn nur so lässt sich vermeiden, dass durch die kausale Verknüpfung einer psychischen Erkrankung mit einer Straftat ein verzerrtes Bild entsteht, das den Eindruck erweckt, dass alle psychisch Kranken potenzielle Straftäter wären.
Dazu kommen bei der Berichterstattung über psychische Erkrankungen natürlich noch die generellen Regeln und Leitsätze für journalistische Arbeit. So sollte sich der Journalist grundsätzlich fragen, ob die psychische Erkrankung für seinen Artikel überhaupt relevant ist.
Außerdem sollte der Journalist prüfen, ob es einen Nachweis dafür gibt, ob und an welcher psychischen Erkrankung die betroffene Person erkrankt ist. Gleichzeitig sollte der Journalist die Richtlinien des Deutschen Pressekodex berücksichtigen. In diesem Zusammenhang sind vor allem die Recherche bei schutzbedürftigen Personen (Richtlinie 4.2), der Persönlichkeitsschutz (Richtlinie 8), Erkrankungen als Teil der Privatsphäre (Richtlinie 8.6) und die Berichterstattung über Straftaten (Richtlinie 12.1) von Bedeutung. Das Aktionsbündnis Seelische Gesundheit hat einen Leitfaden für die Berichterstattung über Menschen mit psychischen Erkrankungen erarbeitet. Darin finden Medienschaffende viele nützliche Infos und hilfreiche Tipps.
Berichterstattung über Suizid unbedingt sachlich
In der Richtlinie 8.7 des Deutschen Pressekodex wird an die Zurückhaltung erinnert, die bei der Berichterstattung über Selbsttötung geboten ist. Im Zusammenhang mit dieser Thematik wird oft vom sogenannten Werther-Effekt gesprochen, der eintreten kann. Dieser Effekt geht auf Goethes Werther zurück.
Als das Werk erschienen war, sollen sich mehrere junge Männer in einer ähnlichen Art das Leben genommen haben. Ein Betroffener, der akut suizidgefährdet ist, durchlebt eine schwere Krise und wähnt sich oft in einer ausweglosen Situation. Häufig ist er dann auch besonders sensibel für Einflüsse von außen. Die Medien wiederum können Vorbilder aufzeigen.
Wird in den Medien sensationsorientiert über eine Selbsttötung berichtet, kann das Betroffene zur Nachahmung verleiten. Je mehr Details geschildert werden, desto größer ist die Gefahr, dass die Vorgehensweise möglichst genau imitiert wird. Andersherum kann aber auch eine stark vereinfachte Darstellung, beispielsweise im Stil von „Selbstmord nach Jobverlust“ oder „Selbsttötung aus Liebe“ die Identifikation erhöhen und eine Nachahmung auslösen.
Der Gegenentwurf zum Werther-Effekt ist der sogenannte Papageno-Effekt. Aus Angst davor, seine geliebte Papagena zu verlieren, denkt der Vogelfänger Papageno in Mozarts Zauberflöte über eine Selbsttötung nach. Doch die drei Knaben zeigen ihm andere Möglichkeiten auf und helfen ihm dadurch, seine Krise zu überwinden. Berichte, die über Auswege und Bewältigungsmöglichkeiten aufklären, haben nachweislich das Potenzial, um Suizide zu verhindern. Denn die Medien können auch Vorbilder im positiven Sinne präsentieren.
Entscheidend bei der Berichterstattung über Suizide ist Sachlichkeit. Eine Selbsttötung darf weder als Heldentat dargestellt noch mit Romantik in Verbindung gebracht werden. Auch Mythen, Vorurteile, zu viele Details oder eine zu starke Vereinfachung sind nicht angemessen.
Eine Selbsttötung ist keine Schlagzeile, sollte aber auch kein Geheimnis umwobenes Tabu bleiben. Es gilt vielmehr, objektiv und sorgsam zu berichten. Einen sehr guten Leitfaden hierzu finden Medienschaffende beispielsweise beim Kriseninterventionszentrum Wien.
Mehr Tipps, Ratgeber, Anleitungen und Presse:
- Infos und Tipps für einen gelungenen Vorspann
- Infos zur Neuformulierung der Richtlinie bei der Berichterstattung über Straftaten
- 5 Tipps für gelungene Bildunterschriften
- 4 SEO-Tipps für Online-Texte
- 7 Tipps für die Themenfindung
- Die größten Fehler im Umgang mit Medien, 2. Teil
Thema: Berichterstattung über psychische Erkrankungen
Übersicht:
Fachartikel
Verzeichnis
Über uns